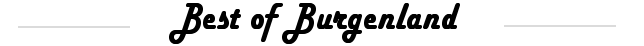Burg, Óvár-Rundweg
Sieben Stationen des Óvár-Rundweges führen auf einer Strecke von rund 1 Kilometer durch die Geschichte von Burg:
Station 1 - Der Rundweg: Der kleine archäologische Rundweg führt, ausgehend von der “Alten Schule” (1) nach Osten zum Kriegerdenkmal (2). Hier wurden die ältesten Objekte von Burg gefunden. Weiter geht es zum sogenannten „Wall“(3), eine Befestigung die über Jahrtausende ausgebaut und verstärkt wurde. Dem Weg folgend gelangt man zur nächsten Station (4). In diesem Bereich wird 2020 eine Forschungsgrabung durchgeführt. Südlich der Friedhofsmauer befindet sich die Infotafel (5) zur höchsten Wehranlage von Burg und den umliegenden Bereichen jenseits der Pinka. Retour geht es nach Nordwesten zur Kirche (6), deren erster Bau nachweislich aus dem 9. Jahrhundert n. Chr. stammt. Der letzte Punkt (7) ist ein Aussichtspunkt von dem aus der früheisenzeitliche (ca. 750 v. Chr.) Nordwall zu sehen ist. Er ist mit etwa 8 m Höhe einer der mächtigsten hallstattzeitlichen Burgwälle Europas.
Station 2 - Kriegerdenkmal: Im Zuge der Fundierung der Südmauer des Kriegerdenkmales im Herbst 1935 konnten in rund 3 Metern Tiefe archäologische Fundmaterialien geborgen werden. Zahlreiche Funde belegen die Besiedlung des Höhenrückens von Burg ab dem 5. Jahrtausend vor Christi.
Station 3 - Der Wallschnitt: Bei Grabungen wurde im Bereich des sogenannten Nordwalles (beim Friedhof) gegraben und die Ergebnisse in Form eines Profilschnittes dokumentiert. Der oberste Teil des Walles, bestehend aus mit Mörtel verlegten Steinplatten aus Grünschiefer, wies eine Mächtigkeit von 1,7 m auf. Diese, auf einer 1,5 m dicken Lehmschicht errichtete Mauerkonsturktion durchschnitt einen Lehmwall, welcher sich nach Innen bis auf eine Höhe von etwa 1,25 Metern fortsetzt. Dieser Lehmwall wurde aus dem lokal vorkommenden Material aufgeschüttet, was durch den Befund eines mit neuerem Schutt verfüllten Grabens belegt werden kann. Weiter nach Innen wurden brandgerötete Flächen sowie Schlacke und Holzkohlefragmente ergraben. Diese anfangs als Eisenverhüttung interpretierten Befunde konnten, nach Parallelisierung mit ungarischen Befunden aus Sopron, als “Rote Schanze” (gebrannte Holz-Lehm-Mauer) interpretiert werden. Diese Bauform wurde in den großen Volksburgen Mitteleuropas im 10. und 11. Jahrhundert nach Christi verwendet.
Station 4 - Die Grabung: Sobald die Bestimmungen des Österreichischen Denkmalschutzgesetzes erfüllt sind kann die eigentliche Ausgrabung beginnen. Zuerst wird der Humus entfernt um die Befunde im Boden sichtbar zu machen. Dann beginnen die Archäologen mit unterschiedlichen Werkzeugen wie Schaufeln, Kellen oder auch Pinseln die archäologischen Befunde und Funde freizulegen zu dokumentieren und zu bergen. Eine Ausgrabung ist in Österreich nach den sogenannten „Richtlinien für archäologische Maßnahmen“ durchzuführen.
Station 5 - Das Rückzugswerk: Bei den Grabungsarbeiten 1952 im Bereich des sogenannten “Rückzugswerkes” (die Burganlage der Herren von Csem) konnte in diesem südlichsten Abschnitt der Höhensiedlung eine Nutzung von der Jungsteinzeit über die Bronze- und Hallstattzeit bis in das 16. Jahrhundert nachgewiesen werden.
Station 6 - Kirche: Der erste Kirchenbau, aller Wahrscheinlichkeit nach aus den Steinen der verfallenen römischen Villa nördlich des heutigen Stausees errichtet, stammt aus dem 9. Jahrhundert n. Chr., was sich durch den Fund des Bruchstückes einer Chorschranke belegen lässt. Vergleichsfunde sind aus dem Raum des heutigen Kroatien, aus Kärnten und aus Norditalien bekannt. Dieses erste Gotteshaus wurde während der folgenden Jahrhunderte dem jeweiligen Baustil angepasst und erweitert. Einige Bauelemente aus vergangenen Epochen, wie etwa das Tor an der Südseite oder ein romanisches Rundbogenfenster, sind bis heute sichtbar.
Station 7 - Der Nordwall: Die Höhensiedlung von Burg ist von mehreren Schutzwällen umgeben. Der äußerste Wall, und somit der Nachweis der größten Ausdehnung der Siedlung, liegt im Norden des Höhenrückens. Er umschließt die große Vorburg der hallstattzeitlichen Fürsten. Dieser früheisenzeitliche Wall, heute noch als markante Erhebung in der Landschaft erkennbar, lässt immer noch das einst mächtige Tor erahnen. Höchstwahrscheinlich war diese Ausdehnung für eine vollständige Verteidigung der Burg Óvár ab dem Ende der Eisenzeit zu groß, weshalb im Frühmittelalter nur der innere, bronzezeitliche Wallabschnitt verstärkt wurde.
Station 1 - Der Rundweg: Der kleine archäologische Rundweg führt, ausgehend von der “Alten Schule” (1) nach Osten zum Kriegerdenkmal (2). Hier wurden die ältesten Objekte von Burg gefunden. Weiter geht es zum sogenannten „Wall“(3), eine Befestigung die über Jahrtausende ausgebaut und verstärkt wurde. Dem Weg folgend gelangt man zur nächsten Station (4). In diesem Bereich wird 2020 eine Forschungsgrabung durchgeführt. Südlich der Friedhofsmauer befindet sich die Infotafel (5) zur höchsten Wehranlage von Burg und den umliegenden Bereichen jenseits der Pinka. Retour geht es nach Nordwesten zur Kirche (6), deren erster Bau nachweislich aus dem 9. Jahrhundert n. Chr. stammt. Der letzte Punkt (7) ist ein Aussichtspunkt von dem aus der früheisenzeitliche (ca. 750 v. Chr.) Nordwall zu sehen ist. Er ist mit etwa 8 m Höhe einer der mächtigsten hallstattzeitlichen Burgwälle Europas.
Station 2 - Kriegerdenkmal: Im Zuge der Fundierung der Südmauer des Kriegerdenkmales im Herbst 1935 konnten in rund 3 Metern Tiefe archäologische Fundmaterialien geborgen werden. Zahlreiche Funde belegen die Besiedlung des Höhenrückens von Burg ab dem 5. Jahrtausend vor Christi.
Station 3 - Der Wallschnitt: Bei Grabungen wurde im Bereich des sogenannten Nordwalles (beim Friedhof) gegraben und die Ergebnisse in Form eines Profilschnittes dokumentiert. Der oberste Teil des Walles, bestehend aus mit Mörtel verlegten Steinplatten aus Grünschiefer, wies eine Mächtigkeit von 1,7 m auf. Diese, auf einer 1,5 m dicken Lehmschicht errichtete Mauerkonsturktion durchschnitt einen Lehmwall, welcher sich nach Innen bis auf eine Höhe von etwa 1,25 Metern fortsetzt. Dieser Lehmwall wurde aus dem lokal vorkommenden Material aufgeschüttet, was durch den Befund eines mit neuerem Schutt verfüllten Grabens belegt werden kann. Weiter nach Innen wurden brandgerötete Flächen sowie Schlacke und Holzkohlefragmente ergraben. Diese anfangs als Eisenverhüttung interpretierten Befunde konnten, nach Parallelisierung mit ungarischen Befunden aus Sopron, als “Rote Schanze” (gebrannte Holz-Lehm-Mauer) interpretiert werden. Diese Bauform wurde in den großen Volksburgen Mitteleuropas im 10. und 11. Jahrhundert nach Christi verwendet.
Station 4 - Die Grabung: Sobald die Bestimmungen des Österreichischen Denkmalschutzgesetzes erfüllt sind kann die eigentliche Ausgrabung beginnen. Zuerst wird der Humus entfernt um die Befunde im Boden sichtbar zu machen. Dann beginnen die Archäologen mit unterschiedlichen Werkzeugen wie Schaufeln, Kellen oder auch Pinseln die archäologischen Befunde und Funde freizulegen zu dokumentieren und zu bergen. Eine Ausgrabung ist in Österreich nach den sogenannten „Richtlinien für archäologische Maßnahmen“ durchzuführen.
Station 5 - Das Rückzugswerk: Bei den Grabungsarbeiten 1952 im Bereich des sogenannten “Rückzugswerkes” (die Burganlage der Herren von Csem) konnte in diesem südlichsten Abschnitt der Höhensiedlung eine Nutzung von der Jungsteinzeit über die Bronze- und Hallstattzeit bis in das 16. Jahrhundert nachgewiesen werden.
Station 6 - Kirche: Der erste Kirchenbau, aller Wahrscheinlichkeit nach aus den Steinen der verfallenen römischen Villa nördlich des heutigen Stausees errichtet, stammt aus dem 9. Jahrhundert n. Chr., was sich durch den Fund des Bruchstückes einer Chorschranke belegen lässt. Vergleichsfunde sind aus dem Raum des heutigen Kroatien, aus Kärnten und aus Norditalien bekannt. Dieses erste Gotteshaus wurde während der folgenden Jahrhunderte dem jeweiligen Baustil angepasst und erweitert. Einige Bauelemente aus vergangenen Epochen, wie etwa das Tor an der Südseite oder ein romanisches Rundbogenfenster, sind bis heute sichtbar.
Station 7 - Der Nordwall: Die Höhensiedlung von Burg ist von mehreren Schutzwällen umgeben. Der äußerste Wall, und somit der Nachweis der größten Ausdehnung der Siedlung, liegt im Norden des Höhenrückens. Er umschließt die große Vorburg der hallstattzeitlichen Fürsten. Dieser früheisenzeitliche Wall, heute noch als markante Erhebung in der Landschaft erkennbar, lässt immer noch das einst mächtige Tor erahnen. Höchstwahrscheinlich war diese Ausdehnung für eine vollständige Verteidigung der Burg Óvár ab dem Ende der Eisenzeit zu groß, weshalb im Frühmittelalter nur der innere, bronzezeitliche Wallabschnitt verstärkt wurde.
Disclaimer
Danke, dass Sie unsere Webseite ausgewählt haben. Wir freuen uns, Sie hier zu haben und möchten unser Wissen mit Ihnen teilen. Sie können uns gerne zu verschiedenen Themen unter der Email office@nikles.net schreiben. Wir antworten in der Regel innerhalb eines Tages.
Die meisten Bilddateien sind aus eigener Quelle und können auf Anfrage kostenlos für eigene Webseiten verwendet werden. Auf Wunsch auch in höherer Auflösung.
Kontakt
Bevorzugte Kontaktaufnahme ist Email.
Email:
office@nikles.net
Website:
www.nikles.net
Günter Nikles,
Josef Reichl-Straße 17a/7,
A-7540 Güssing
Österreich